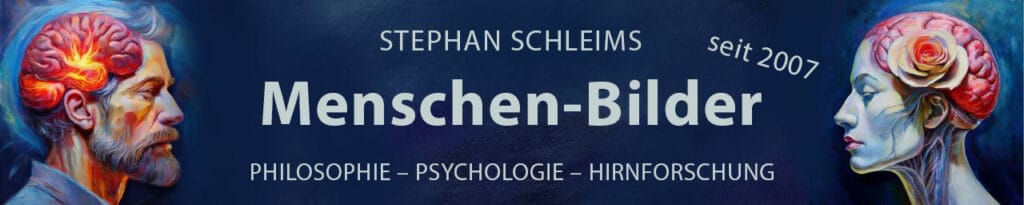Warum sie für die Gesellschaft so wichtig sind
Wissenschaft und Journalismus haben mindestens ein Ziel gemeinsam, nämlich das der Wahrheitssuche. Schon in der Präambel des Pressekodex des Deutschen Presserats findet sich der Passus, dass Journalisten ihre Arbeit „nach bestem Wissen und Gewissen, unbeeinflusst von persönlichen Interessen und sachfremden Beweggründen“ wahrnehmen sollen.
Darauf folgt, in Ziffer 1, Wahrhaftigkeit: „Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. Jede in der Presse tätige Person wahrt auf dieser Grundlage das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Medien.“
Demgemäß geht es in Ziffer 2, Sorgfalt, weiter. Die Recherche sei unverzichtbar und ihre Ergebnisse seien „mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben.“ Ziffer 3, Richtigstellung, enthält den Auftrag, Fehler „unverzüglich von sich aus in angemessener Weise richtig zu stellen.“
Und analog dazu heißt es im ersten Artikel der Globalen Ethik-Charta der Internationalen Vereinigung der Journalisten: „Der Respekt vor den Fakten und dem Recht der Öffentlichkeit auf Wahrheit ist die oberste Pflicht des Journalisten.“ Von Fakten und der Treue zu ihnen ist in der Charta ganze sechsmal die Rede.
Transparenz
Die folgenden Gedanken will ich am Beispiel des 1995 gegründeten Telepolis-Magazins entwickeln. Da ich dort in der Zeit vom 27. Januar 2005 bis zum 27. Juli 2022 stolze 283 Artikel veröffentlichte, kann ich in der Sache natürlich nicht ganz unbefangen sein.
Indem ich diese Information voranstelle, können die Leserinnen und Leser ihre eigenen Schlüsse ziehen. Wer will, kann diesen Text also besonders kritisch lesen.
Hinweis: Mit einem Abonnement des Newsletters verpassen Sie keinen Blogbeitrag mehr.
Geld
Am Anfang haben wir von den hehren Werten und Zielen des Journalismus gelesen. Nun wissen wir aber alle, dass diese mit eher weltlichen Werten und Zielen in Konflikt stehen: nämlich dem Gewinnstreben. Der weltlichste aller Werte ist das Geld.
Nun hat gerade das Internet mit seinen überall verfügbaren Gratis-Inhalten zu einer Gratis-Mentalität bei Leserinnen und Lesern geführt, die klassische Medien in die Bredouille brachte: Warum soll man schließlich für etwas zahlen, das man überall kostenlos bekommt? Klammern wir im Folgenden die Öffentlich-Rechtlichen aus, auch wenn darüber viel zu sagen wäre; warum zum Beispiel deren Intendanten dafür, dass sie anderen bei der Arbeit zugucken, zwischen 250.000 und 415.000 Euro im Jahr (Zahlen für 2023) verdienen müssen – exklusive Aufwandsentschädigung und Sachbezüge, versteht sich.
Auf dem freien Markt aber muss es zu dem kommen, was man in Marketingsprache „conversion“ nennt: Damit ist kein Glaubenswechsel gemeint, sondern der Wechsel vom klickenden und lesenden zum zahlenden Kunden. Kurzum, ein Verlag kann in der Regel kein reines Hobbyprojekt sein, sondern muss Inhalte anbieten, für die genug Leute Geld springen lassen – oder zumindest über Werbung Dienstleistungen oder Produkte kaufen.
Interessenkonflikte
Die eingangs erwähnten Pressekodizes äußern sich darüber, wie Journalisten arbeiten sollten. Sie verraten aber nicht, wie das profitabel sein kann. Und so sind Journalisten und Redakteure, die Inhalte bereitstellen, oft im arbeitsrechtlichen Sinne an Weisungen des Chefredakteurs und Herausgebers gebunden. Über all dem steht schließlich der Verleger, dem das alles gehört.
Wer den Entscheidungen von oben nicht Folge leistet, dem droht die Entlassung; und ein Verlag, der nicht profitabel ist, steht vorm Konkurs. Das sind die Selektionsmechanismen des Marktes, die dafür sorgen, dass sich die jedenfalls bei den Verlagshäusern verfügbaren Inhalte unterm Strich gut genug verkaufen müssen. Je weniger das durch die direkte Vermarktung an die lesenden Kunden passiert, desto wichtiger wird der Werbemarkt. Und das führt dann zu einer Abhängigkeit von den Werbekunden.
Noch zwei Gedanken am Rande: Vergessen wir nicht, dass die Multimilliardenunternehmen wie Alphabet (mit u.a. Google) und Meta (mit u.a. Facebook und Instagram; WhatsApp soll bald auch Werbung bekommen) überhaupt erst durch personalisierte Werbung riesengroß wurden. Und auch in der Wissenschaft steht das Ideal der Unabhängigkeit aufgrund von Wettbewerb und Mittelkürzungen unter dem realen Druck des Drittemittelzwangs.
Aus der Marktlogik ergibt sich der Interessenkonflikt – und zwar sowohl im Journalismus als auch in der Wissenschaft – zwischen unabhängiger Wahrheitssuche und abhängiger Profitfindung. Wer bei Letzterer durchfällt, wird in fast schon Darwin’scher Manier ausselektiert. Wir erinnern uns, dass die Sozialdarwinisten diese Logik auf die gesamte Gesellschaft übertrugen und das für das natürliche Ideal hielten. (Kein Wunder: Mit ihrem Wohlstand standen sie ganz oben – und wollten dort auch bleiben.)
Die Heise Gruppe
Die Marktlogik müssen wir also im Hinterkopf behalten. Wenn, wie ich es aus eigener Erfahrung oft genug erlebt habe, vom (Chef-) Redakteur die Antwort kommt, der angebotene Inhalt sei nicht geeignet, nicht zielgruppenkonform oder schlicht nicht gut genug, kann sich dahinter viel verbergen. Vielleicht ist es so, wie man gesagt bekommt. Vielleicht ist das aber auch eine Chiffre, die Geheimsprache dafür, dass der Inhalt nicht profitabel genug ist – oder nicht zu dem Bild passt, das die Führungsebene vor Augen hat.
(Der größte Witz meiner publizistischen Tätigkeit war ein Chefredakteur einer großen Wochenzeitung, der meine Replik zur Frage, ob der Kapitalismus die Menschen krank macht, trotz meiner höflichen Nachfragen so lange ignorierte, bis er sie mit der Begründung ablehnte, der Text sei inzwischen zu alt. Auch so erhält man die „Qualität“ aufrecht.)
Das müssen wir alles mitdenken, wenn wir uns jetzt mit den Vorgängen von Telepolis beschäftigen, einer Tochter der Heise Gruppe GmbH & Co. KG, der – unter anderem – auch die Computerzeitschriften c’t und iX sowie Technology Review und mehrere Buchverlage gehören. Nebenbei: Der c’t bin ich seit August 1996 als zahlender Leser treu.
Qualitätsoffensive
Nun startete Telepolis nach dem Wechsel des Chefredakteurs – 2021 folgte Harald Neuber auf den in den Ruhestand gehenden Florian Rötzer – eine „Qualitätsoffensive“. Zunächst erhielten alle Artikel aus der Rötzer-Zeit einen Warnhinweis, dass sie möglicherweise nicht mehr den neuen Qualitätsstandards genügen. Heute lauter der Disclaimer: „Der folgende Beitrag ist vor 2021 erschienen. Unsere Redaktion hat seither ein neues Leitbild und redaktionelle Standards.“
Ich selbst beendete nach meinem Artikel vom 27. Juli 2022 die Zusammenarbeit. Man muss hier keine schmutzige Wäsche waschen. Wenn man sagt, dass es menschlich nicht mehr so harmonierte, würden dem vielleicht beide Seiten zustimmen. Auch viele andere Autorinnen und Autoren hörten damals auf. Weil ich die Art des Abschieds nach wohlgemerkt 17 Jahren(!) problemloser Zusammenarbeit schade fand, schrieb ich dem Mutterverlag noch eine E-Mail – und erhielt darauf keine Antwort. Das bestätigte mich in meinem Entschluss.
Dieser sollte mir die Verlegenheit ersparen, als aktiver Autor zu der zweiten, noch viel einschneidenderen Stufe der „Qualitätsoffensive“ direkt Stellung beziehen zu müssen: Zum 6. Dezember 2024 verschwanden über 70.000 zuvor schon gebrandmarkte Telepolis-Artikel aus 25 Jahren Internetgeschichte mit der Erklärung „Qualitätsoffensive: Telepolis überprüft historische Artikel“ einfach so vom Netz. So liefen auch unzählige Links anderer Webseiten, darunter Wikipedia, und journalistischer wie wissenschaftlicher Fachliteratur auf einmal ins Leere.
Meines Wissens wurde keiner der betroffenen Autoren hierüber im Voraus informiert – nicht einmal der frühere Chefredakteur Florian Rötzer, der in den Jahren 1995-2020 viel Herzblut in das Projekt gesteckt haben muss. Ironischerweise wurden sogar die alten Artikel vom neuen Chefredakteur von diesen Schritten miterfasst: erst deklassiert, dann ganz entfernt.
Wiederauferstehung
Wir wissen natürlich nicht, welche Vorgaben Verleger und Herausgeber hier gemacht haben, und ich will darüber auch nicht spekulieren. Aber Harald Neuber musste sie als weisungsgebundener Angestellter umsetzen – oder vielleicht gehen. Das bedeutete, sogar seine eigenen Beiträge mit dem Disclaimer zu versehen (z.B. hier) und vom Netz zu nehmen. Wir wissen nur, wie die Redaktion ihre Schritte nach außen rechtfertigte.
Die über 70.000 Artikel sind nun, nach einem guten halben Jahr, wieder von den Toten auferstanden. Im Interview vom 30. Juni erklärte der neue Chefredakteur: „Es war von Anfang an so geplant – und da muss ich selbstkritisch sagen, das hätten wir deutlicher kommunizieren müssen. Es war aber auch nirgendwo angekündigt, dass wir diese Artikel offline nehmen und sie nie wieder auftauchen. Beides ist Quatsch. Es wurde nur hineininterpretiert.“
Wenn man das aber mit der erwähnten Erklärung vom 6. Dezember 2024 vergleicht, kommen Fragen auf. Darin hieß es nämlich: „Viele Archivperlen werden neu erscheinen.“ Und: „Wir werden die alten Inhalte systematisch und so schnell wie möglich sichten und – soweit sie noch einen Mehrwert bieten – nach unseren Qualitätskriterien bewerten und überarbeiten. Essays und Fachaufsätze haben dabei Vorrang, tagesaktuelle Texte aus der Vergangenheit nicht. Schrittweise sollen die vielen Perlen aus dem Archiv wieder zugänglich gemacht werden …“
Das klingt für mich so, als wollte man nur die Inhalte einiger ausgewählter Autorinnen und Autoren wieder veröffentlichen. In der Folge wird dann auch eine Positivliste „herausragender Autoren“ genannt: Stanislaw Lem, Cory Doctorow, Jaron Lanier, Evgeny Morozov, Mark Amerika, Douglas Rushkoff, Michael Goldhaber, Martin Pawley, Christoph Butterwegge sowie Christian Hacke. Und für ganz am Ende der Liste hat man sogar noch zwei Frauen gefunden: Margot Käßmann und Antje Vollmer.
Der Artikel schließt mit dem Versprechen: „Freuen Sie sich also darauf, diese Inhalte demnächst überarbeitet und in neuer Aufmachung bei Telepolis wiederzufinden.“
Wunsch und Realität
Ich kann mir einfach keinen Reim darauf machen, wie die Ankündigung vom Ende 2024 und die Schritte vom Sommer 2025 zusammenpassen: Dem Anschein nach wurde nichts überarbeitet oder in neuer Aufmachung neu veröffentlicht, sondern schlicht der Zustand von vorm Dezember 2024 wiederhergestellt. Artikel aus der Zeit der alten Redaktionsleitung sind mit der genannten Distanzierung versehen.
Doch eine wichtige Ausnahme gibt es: Die Texte bestimmter Autoren sind jetzt in ein neues „Telepolis Archiv“ verschoben. Dort heißt es: „Das Telepolis Archiv enthält Beiträge bis 2021. Diese sind nicht mehr Teil des aktuellen Angebots, bleiben aber über Direktlinks weiterhin erreichbar.“ Ein wichtiger Unterschied: Bei der Suche auf der Hauptseite heise.de erscheinen diese nicht mehr als Resultat. Außerdem wurden alle Abbildungen entfernt. Neuber erklärt, dass diese urheberrechtlich problematisch sein und die Gefahr von Abmahnungen mit sich bringen könnten.
Formal stört sich der neue Chefredakteur an der seiner Meinung nach unzureichenden Trennung von journalistischen Inhalten und Meinungsartikeln bei den alten Texten. Laut seinem Artikel vom 5. Juli sind ihm insbesondere Publikationen aus „Krisenzeiten wie nach 9/11, während der sogenannten Flüchtlingskrise oder der Corona-Pandemie“ ein Dorn im Auge.
Wie es weitergeht
Er stellt die Frage, „Wie weiter mit tendenziell problematischen Inhalten?“, und antwortet nach meinem Verständnis etwas kryptisch: „Noch nicht entschieden haben wir, ob wir die unserer Meinung nach problematischen Inhalte … nach der Umstellung von Telepolis auf ein neues Contentmanagementsystem in diesem Jahr weiter zur Verfügung stellen. Doch auch wenn wir die Links nicht weiter anbieten, bleiben sie bestehen. Verlinkungen funktionieren wieder und sie sind über gängige Suchmaschinen auffindbar.“
Wie können Links bestehen bleiben, wenn man sie nicht weiter anbietet? Da Recherche für gute journalistische Arbeit ebenso unerlässlich ist wie – laut Neuber selbst – das Einholen unterschiedlicher Sichtweisen, habe ich den neuen Chefredakteur selbst gefragt. Seit Montagmorgen, den 7. Juli um 5:30 Uhr konnte er mir darauf (noch) keine Antwort geben.
So bleibt ein weiteres Fragezeichen der redaktionellen Arbeit im Raum stehen.
Schuss nach hinten?
Alles in allem wirkt es so auf mich, als sei man von der „Qualitätsoffensive“ in eine Kommunikationsdefensive geraten. Die alten Inhalte sind wieder da, offenbar ohne Überarbeitung, doch zum Teil ohne Bilder und ausgeschlossen von der Suchfunktion des Verlags.
Was schrittweise geschehen sollte, passierte plötzlich. Übrigens scheint mir die Ankündigung, alte Texte von zum Teil gar nicht mehr lebenden Autoren in neuer Überarbeitung zu veröffentlichen, rechtlich nicht unproblematisch.
Kommunikative Defizite hat Neuber selbst eingeräumt. Beim Vergleich der Erklärungen vom Dezember 2024 und Sommer 2025 ergeben sich Widersprüche. Man kann sich schon fragen, wozu das alles, wenn die alten Texte angeblich nur noch drei Prozent des Online-Verkehrs ausmachen? Und wenn man sich unbedingt von deren Inhalten distanzieren will, hätte dann der Disclaimer nicht gereicht?
Leserkontakt
Ein Teil der „Qualitätsinitiative“ besteht übrigens darin, Diskussionen nur noch bei einem Teil der Artikel zuzulassen. Ich erinnere mich noch an Zeiten, in denen die Diskussionsforen zu manchen Texten mitunter vierstellige Kommentarzahlen erreichten. Verglichen damit geht es heute sehr ruhig zu.
Es stimmt zwar, dass in den letzten Jahren immer mehr Verlage ihre Kommentarbereiche einschränkten oder gleich ganz schlossen. Das hat meiner Meinung nach aber die Unzufriedenheit vieler Leserinnen und Leser nur noch vergrößert: Niemand lässt sich gern von seiner Redaktion den Mund verbieten.
Wenn, wie laut Neuber, zur Moderation ungenügend Ressourcen zur Verfügung stehen, könnte man auch überlegen, ob man zu viel moderiert. Warum entscheidet man sich nicht im Zweifel für die Meinungsäußerungsfreiheit und entfernt nur strafrechtlich relevante Inhalte?
Jedenfalls ist der Ton im Netz nicht dadurch weniger rau geworden, dass diese User nun auf X oder in Telegram-Kanälen kommunizieren müssen; wahrscheinlich sogar eher im Gegenteil.
Das letzte Wort
Ich fing mit journalistischen Standards an und uns sollte jetzt klar geworden sein, wer hier das letzte Wort hat: der Chefredakteur, über ihm der Herausgeber und über dem der Verleger – im Rechtsstaat natürlich im Streitfall über allem die Gerichte. Die „Qualitätsoffensive“ von Telepolis führt uns vor Augen, dass weite Teile des Internets unter dem Vorbehalt kommerzieller Anbieter und ihrer Interessen stehen.
Unabhängigkeit, Neutralität, Faktentreue, Wahrheitsfindung – das sind alles hehre Ziele. Als Orientierung sind sie – sowohl im Journalismus als auch in der Wissenschaft – trotzdem wichtig, weswegen die eingangs zitierten Pressekodizes auch sinnvoll sind. Auf dem Markt einer kapitalistischen Gesellschaft stehen sie aber letztlich unter dem Vorbehalt der Profitabilität.
Man muss nicht aktiv lügen, um eine Aussage zu verfälschen. Man kann auch durch die Selektion oder bestimmtes Framing von Fakten die Botschaft verbreiten, die einem gefällt. Das fängt schon bei der Auswahl von Redaktionen an, was sie für berichtenswert halten, welche Quellen sie einbeziehen und welcher Sichtweise sie wie viel Raum geben. Bei den klassischen Medien ist die politische Ausrichtung klar, ist die FAZ etwa eher als rechtskonservativ, die taz eher als linksprogressiv und die Bild vor allem als plakativ bekannt. Wenn das allen bewusst ist, lässt sich das eher einordnen.
Fazit
Sogar in der Wissenschaft gibt es keine reine Objektivität: Schon bei der Bewertung von Seminararbeiten gehen die Meinungen auseinander, Teile der Naturwissenschaften vielleicht ausgenommen. Das wichtige Vieraugenprinzip (peer review) kann nur so gut sein, wie die Gutachter, die man einbezieht. Und auch die Ergebnisse randomisierter kontrollierter Studien (RCTs) lassen sich zum Beispiel durch die Einschlusskriterien und Vorauswahl von Versuchspersonen beeinflussen, in ähnlicher weise die Meta-Analysen.
Der berühmte kanadische Wissenschaftstheoretiker Ian Hacking (1936-2023) sagte einmal auf einer Tagung: Nach Objektivität sollte man zwar streben, doch nicht so viel darüber reden. Auch das Streben nach mehr Qualität in den Medien ist redlich. Nach meinem Ergebnis wirkt die „Qualitätsoffensive“ von Telepolis bisher jedoch eher übereilt und chaotisch. Aber sie gab uns immerhin den Anlass, über wichtige Prinzipien in Journalismus und Wissenschaft nachzudenken.
Was bleibt nun von der „Offensive“? Ein Warnhinweis. Die Kommunikation der Redaktion ließ nach eigenem Bekunden zu wünschen übrig. Über 70.000 Artikel, die ohnehin kaum aufgerufen werden, waren vorübergehend offline. Ein Teil ist jetzt im getrennten Archiv, das wie ein Giftschrank funktioniert.
Die Grenzziehung wirkt dabei willkürlich: Beispielsweise sind die Artikel des früheren Chefredakteurs Florian Rötzer bis zum 31.12.2020 jetzt im Giftschrank verschwunden (z.B. hier). Nachdem sich der Zeiger über die Grenze zum Neujahr schob, erfüllten Rötzers Artikel dem Anschein nach auf einmal die neuen Qualitätsstandards (z.B. hier). Diese (angeblich) die Qualität sichernde Maßnahme verordnete der neue Chefredakteur seinen eigenen Artikeln allerdings nicht (z.B. hier). Und das, obwohl sie unter der Aufsicht des jetzt gebrandmarkten Vorgängers veröffentlicht wurden.
Das entfernen der Abbildungen im Archiv ist übrigens so unschuldig nicht: Artikel, in denen diese eine argumentative Funktion erfüllten, sind jetzt nicht mehr nachvollziehbar.
Ob der Stichtag 1.1.2021 den Beginn eines Qualitätszeitalters markiert, mögen die Leserinnen und Leser selbst entscheiden. Was das mit dem eingangs erwähnten journalistischen Auftrag zur Wahrheitsfindung zu tun hat, erschließt sich mir jedenfalls nicht.
Abbildung: von geralt, Pixabay-Lizenz.