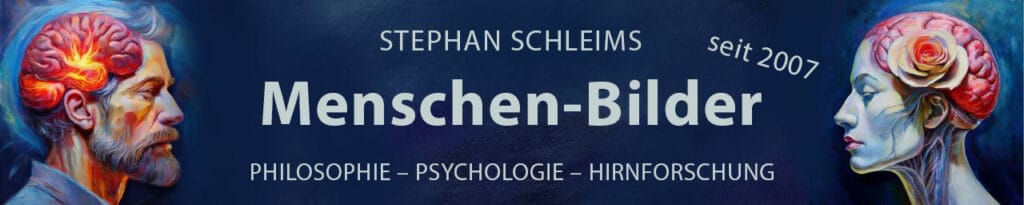Cannabis auf Platz 1. Über die Motive für den Konsum spricht weiterhin so gut wie niemand
Am „Weltdrogentag“, dem 26. Juni, veröffentlichte das Büro für Drogen und Kriminalität der Vereinten Nationen seinen neuesten Drogenreport. Demnach haben im Jahr 2023 – ohne Alkohol und Tabak – mit 316 Millionen Menschen mehr denn je Drogen konsumiert. Das sagt schon sehr viel über die fragliche Effektivität der nach wie vor von konservativen Parteien befürworteten Verbotspolitik aus.
Nähme man die beiden bei uns traditionell eher als Genussmittel bekannten Substanzen Alkohol und Tabak dazu, käme man auf mehrere Milliarden. Darüber schweigt der Drogenreport aber. Darin äußert sich eine westliche Sichtweise auf das Problem, denn in islamisch geprägten Kulturen sieht man Alkohol wegen des im Koran erwähnten Verbots des Konsums vergorener Trauben kritischer. Doch auch hier gab es zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten mehr oder weniger strenge Interpretationen.
Willkürliche Grenzziehung
Aus biochemischer Sicht ist diese Grenzziehung aber willkürlich. Als „Droge“ könnte man hier am ehesten diejenigen Substanzen auffassen, die durch die Blut-Gehirn-Schranke gelangen, die Aktivität der Hirn-Botenstoffe verändern und so zu bestimmten Veränderungen im Erleben und Verhalten der Konsumierenden führen.
In der gesellschaftlichen Praxis sieht man es pragmatisch: Für die Medizin sind diejenigen psychoaktiven Substanzen Drogen, die die Menschen ohne Rezept beziehungsweise nicht über die etablierten pharmakologischen Wege beziehen. Und für Juristen und die Behörden ist die Aufnahme der Substanzen auf eine Drogenliste, in Deutschland im Wesentlichen die Anlage zum Betäubungsmittelgesetz (BtMG), entscheidend.
Das führt zu der merkwürdigen Konsequenz, dass ein und dasselbe Molekül mal Lifestyle- oder Genussmittel, mal Medikament und mal verbotene Droge sein kann. Wenn zum Beispiel jemand Amphetamin („Speed“) auf Rezept zur Behandlung von ADHS-Symptomen erhält, ist das rechtlich ein Medikament; besorgt sich dieselbe Person aber vielleicht sogar aus denselben Gründen genau dieselbe Substanz, dann ist es rechtlich eine Droge und kann der Besitz bestraft werden.
Straftat ohne Opfer
Nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 BtMG ist das eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Das ist dasselbe Strafmaß wie für eine Körperverletzung (§ 223 StGB). Doch während man bei Letzterer tatsächlich jemandem schadet, bezeichnen Kritiker zumindest die einfachen Drogendelikte mitunter als „Straftat ohne Opfer“.
Darauf erwidert man, dass vielleicht nicht jeder Drogenkonsum unmittelbar zu einem körperlichen, psychischen oder gesellschaftlichen Schaden führt, doch wenigstens das Risiko hierfür erhöhe. Dass das aber auch für die nicht verbotenen Substanzen gilt und sogar für viele „normale“ Freizeitaktivitäten wie Autofahren, Sonnenbaden oder Sport, darüber sieht man hinweg.
Was ich damit sagen will: Wenn wir über Drogenpolitik reden, schauen wir immer durch eine bestimmte gesellschaftlich geprägte Brille auf das Problem. Das fängt schon beim Begriff der Droge selbst an. Im Endeffekt läuft es auf die Logik hinaus, dass bestimmte Substanzen verboten sind, eben weil sie auf einer Verbotsliste stehen; und dass sie auf der Verbotsliste stehen, eben weil bestimmte, einflussreiche Gruppierungen sie daraufgesetzt haben.
Man könnte es auch so sagen: Drogen sind genau dann verboten, wenn und weil sie verboten sind.
Die Durchsetzung dieser „Logik“ lassen sich moderne Rechtsstaaten, deren Vorläufer noch bis ins frühe 20. Jahrhundert als Kolonialmächte selbst die größten Drogendealer waren, heute Milliarden kosten. Und wie erfolgreich das ist, darüber gibt zum Beispiel der Weltdrogenreport der Vereinten Nationen jährlich Aufschluss.
Rangliste der Drogen
Die vorangegangenen Ausführungen sollen uns daran erinnern, dass bei diesem Thema traditionelle, machtpolitische und moralische Fragen durcheinandergehen. Zu anderen Zeiten und an anderen Orten dachte man anders über Drogen – oder hatte man vielleicht noch nicht einmal einen besonderen Begriff davon. Ob das bessere oder schlechtere Zeiten und Orte waren, ist ein interessantes Forschungsgebiet.
Doch der Drogenreport handelt von der Realität, in der wir heute leben. Und demnach stand Cannabis in dem erhobenen Jahr 2023 mit 244 Millionen Konsumierenden auf Platz 1. Danach folgten Opioide (61 Millionen), Amphetamine (31 Millionen), Kokain (25 Millionen) und Ecstasy (21 Millionen).
Das wird mit der Meldung flankiert, dass im selben Jahr auch von den Polizeibehörden mehr Amphetamin und Methamphetamin denn je beschlagnahmt wurde. Ob das auf bessere Polizeiarbeit, mehr Schmuggel oder beides zurückgeht, lässt sich nicht genau sagen. Denn aufgrund der Verbote findet der Handel ja im Dunkelfeld statt.
Teure Konsequenzen
Das Büro für Drogen und Kriminalität der Vereinten Nationen weist auch auf die teuren Folgen des Problems hin: So habe 2023 nur eine von zwölf Personen mit problematischem Substanzkonsum dafür eine Behandlung erhalten. Und sowohl bei der Herstellung als auch der Bekämpfung von Drogen könne es zur Verschmutzung oder gar Zerstörung der Natur kommen.
Wenn man schon Drogenkrimineller ist, braucht man den Umweltschutz auch nicht mehr ernst zu nehmen. Und bei Razzien werden die Plantagen in der Regel zerstört, mit Kollateralschäden für Flora und Fauna. Das gilt natürlich nur für Drogen wie Kokain oder Opiate (z.B. Diamorphin/Heroin, Dihydrohydroxycodeinon/Oxycodon), die nicht vollständig synthetisch im Labor hergestellt werden. Bei Letzteren fallen aber chemische Abfälle an, die man dann oft illegal irgendwo verbuddelt oder einfach liegenlässt.
Dabei sind, wohlgemerkt, die Kosten für die Aufrechterhaltung der Verbotspolitik noch nicht einmal eingerechnet: Man denke an die Finanzierung der Polizeiarbeit und Justiz, die für die Gesellschaft und Individuen verlorene Produktivität durch Gefängnisstrafen, die Kosten für die Gefängnisse und so weiter.
Dieser ganze Apparat war, jedenfalls im heutigen Ausmaß, in der Menschheitsgeschichte lange Zeit unbekannt. Es handelt sich um eine gesellschaftliche „Innovation“ vor allem auf Betreiben religiös-fanatischer Politiker der USA. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde die Verbotspolitik über den Völkerbund und dann die Vereinten Nationen international durchgesetzt.
Vervielfältigung von Problemen
Wenn man meint, nicht schon genug gesellschaftliche Probleme zu haben, dann kann man sie politisch vervielfältigen. Mit der geschürten Angst – sowohl vor den Konsumierenden als auch den kriminellen Organisationen – kann man im Wahlkampf auf Stimmenfang gehen.
Dass das bis heute gilt, sah man zuletzt bei der Entkriminalisierung von Cannabis im letzten Jahr. Dafür scheuten manche Unionspolitiker nicht einmal vorm Rechtsbruch zurück: Man erinnere sich zum Beispiel an die historische Abstimmung im Bundesrat vom 22. März 2024, bei der Ministerpräsident Michael Kretschmers Verhalten zur Disqualifikation seines Bundeslands führte.
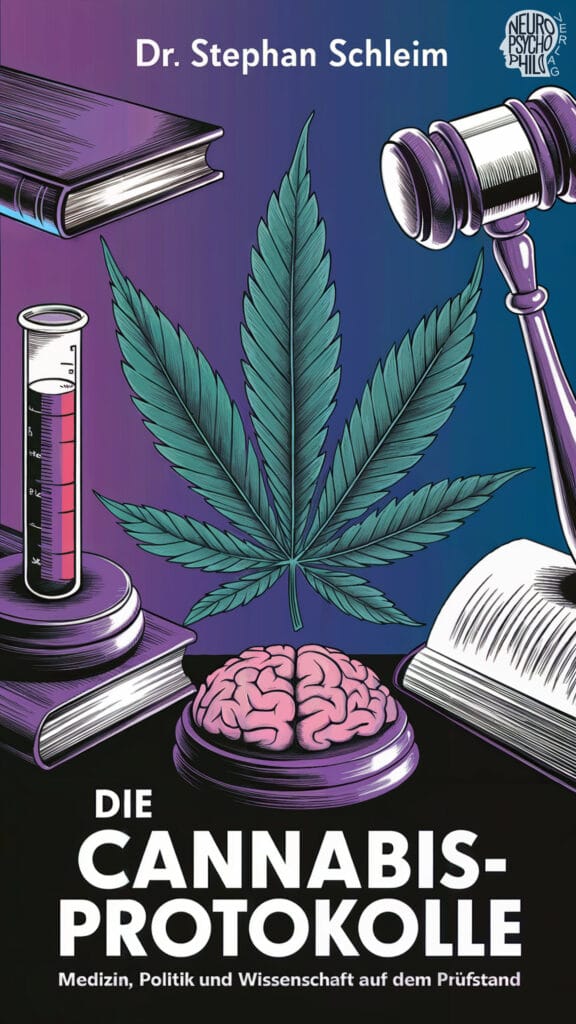
Erfahren Sie mehr über die Cannabis-Gesetzgebung sowie wichtige Grundlagen: Was ist eine Droge? Was ist Abhängigkeit? Seit wann gibt es Cannabiskonsum in der Menschheitsgeschichte? Und was sind sein Nutzen und seine Risiken? Das neue Buch von Stephan Schleim gibt es als eBook für nur 9,99 Euro bei Amazon, Apple Books und Google Play Books.
Man wollte die Welt oder jedenfalls Deutschland retten. Der Versuch scheiterte, insbesondere dank der Standhaftigkeit von Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Und trotzdem ist das Land nicht untergegangen. Jedenfalls nicht wegen des Cannabiskonsums.
Dabei finden die Jugendlichen, deren Schutz einem (angeblich) am meisten am Herzen liegt, Cannabis zunehmend langweilig. Auch das zeigt der neue Drogenbericht der Vereinten Nationen, wonach von den späten 1990ern bis zur Coronapandemie konstant um die 15 bis 17 Prozent der 15- und 16-Jährigen Cannabis zumindest schon einmal probiert hatten. Das fiel in den letzten Jahren auf 12 bis 13 Prozent.
Und laut der Frankfurter Drogentrendstudie hatten 2015 noch 34 Prozent der 15- bis 18-Jährigen immerhin im letzten Monat Cannabis konsumiert. 2024 waren es nur noch die Hälfte, nämlich genau 17 Prozent. Auch Drogenkonsum kennt seine Moden, die sich nicht zwingend an die Logik der Drogenpolitiker hält.
Paradoxien
Die ist sowieso äußerst flexibel. Wo man vor der letzten Bundestagswahl noch vollmundig ankündigte, Cannabis sofort wieder verbieten zu wollen, weil Gesundheitsschutz und so, steht das Vorhaben nun nicht einmal im Koalitionsvertrag. Man will nun erst einmal die Evaluationen abwarten.
Und was die Verbote nutzen sollen, wenn die Leute im Endeffekt doch das konsumieren, was sie wollen, darauf gibt man nie eine Antwort. Wie gesagt: Drogen sind genau dann verboten, wenn und weil sie verboten sind. Noch Fragen?
Paradoxerweise lassen sich nicht einmal Justizvollzugsanstalten drogenfrei halten. Im Gegenteil werden die Mittel dann zu einer Ersatzwährung. In US-Gefängnissen, in denen sogar Zigaretten verboten sind, fängt das mit einem Häufchen in Toilettenpapier gewickelten Tabak an. Und manch ein Wärter verdient mit dem Schmuggel ein paar Hundert Dollar pro Woche nebenbei. Steuerfrei, versteht sich.
Paradoxerweise waren – daran soll hier noch einmal erinnert werden – die im Laufe des 20. Jahrhunderts zunehmend dämonisierten und als Geißel der Menschheit dargestellten Substanzen wie Opium, Morphium, Kokain und sogar das angeblich Übelste aller Üblen, Heroin, medizinisch für lange Zeit so angesehene wie wichtige Stoffe.
Und obwohl Diamorphin/Heroin so übel sein soll, hat man mir nach meiner Gallenblasenoperation 2018 das vielfach stärkere Oxycodon, das auf demselben Mechanismus beruht, einfach so gespritzt. Einfach so, ohne mich zu fragen. Ihnen vielleicht auch schon einmal. Und Sie haben sich wahrscheinlich nichts weiter dabei gedacht, weil man es ein „Schmerzmittel“ nannte und Sie sich damit gut fühlten.
Ja, Wörter haben eine besondere Macht: Besonders ärztliche Worte machen aus bösen Drogen gute Medikamente.
Motive, Nutzen, Zwang
Trotz alledem überbietet man sich in Diskussionen zum Thema üblicherweise mit Angaben über mögliche Risiken und Schäden. Über die Motive und den Nutzen des Substanzkonsums verliert man aber kein Wort. Das sah man jüngst wieder beim Tagesschau-Bericht „Zahl der Drogenkonsumenten auf Rekordhoch“ zum neuen Drogenreport am 26. Juni.
Man muss kein Einstein sein, um die Antwort auf die Frage nach dem Warum zu beantworten: Menschen nehmen psychoaktive Substanzen in der Regel, weil ihnen die Auswirkungen auf ihr Erleben und Verhalten gefallen; weil, mit anderen Worten, psychoaktive Substanzen Instrumente zum Erreichen bestimmter Zustände sind.
Das kippt natürlich an dem Punkt um, wo die freiwillige Entscheidung zum Zwang wird. Dann wird aus der Suche nach einem psychischen Zustand, der einem besser gefällt, die Flucht vor einem, den man nicht ertragen kann. Anders als oft angenommen steckt in der „Sucht“ nicht nur das Siechen, also Krankheit, sondern durchaus auch das zwanghafte, das die eigene Kontrolle übersteigende Suchen nach etwas. (Sprachliebhaber mögen sich die zahlreichen im Wörterbuch auf „-sucht“ endenden Substantive anschauen – und staunen.)
Nach dieser Darstellung des Status quo beschäftigen wir uns im zweiten Teil des Artikels mit den gesellschaftlichen und drogenpolitischen Konsequenzen.
Abbildung: von Dee, Pixabay-Lizenz.