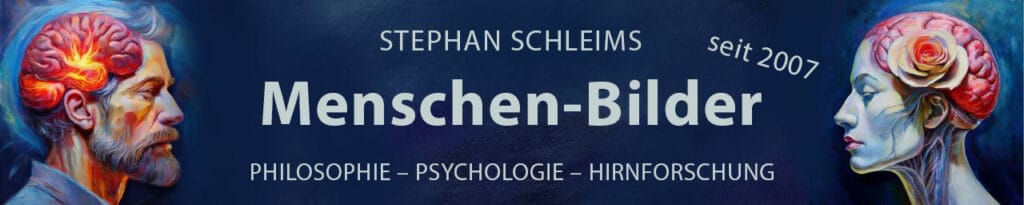Eine Welt ohne Substanzkonsum ist unrealistisch. Wie könnte eine damit idealerweise aussehen?
Im ersten Teil behandelten wir den zum Weltdrogentag (26. Juni) von den Vereinten Nationen veröffentlichten neuen Jahresbericht. Demnach konsumieren mehr Menschen denn je psychoaktive Substanzen, wobei man – wohl durch eine westliche Brille – Alkohol und Tabak ausklammert. Außerdem sahen wir, dass schon der Begriff „Droge“ nicht neutral definiert, sondern von Interessen und Werten geprägt ist.
Der Diskurs wird vor allem gesundheitspolitisch und mit Blick auf die Risiken geführt. Dass die Verbote offenbar kaum funktionieren, die Probleme vielleicht sogar vergrößern und sich Menschen aus bestimmten Gründen für den Substanzkonsum entscheiden, wird seltener thematisiert.
Freiheit…
So geht ein wichtiges Grundprinzip des liberalen Rechtsstaats in der drogenpolitischen Diskussion regelmäßig unter: nämlich das Prinzip der freien Entscheidung zumindest von erwachsenen Menschen über sich selbst, das Prinzip der Selbstbestimmung. Und damit auch über Mittel und Wege zum Erreichen der von ihnen gewünschten psychischen Zustände.
Es war nicht zufällig, dass Sucht im Zuge des im ersten Teil genannten politischen-religiösen Fanatismus erstmals offiziell als medizinisches Problem klassifiziert wurde, nämlich in den 1930ern in den USA. Doch auch (fast) 100 Jahre später haben sich Mediziner nicht auf eine einheitliche Definition des Suchtbegriffs einigen können. Er ist fast so (un)logisch wie die Drogenverbote selbst.
Die medizinischen Standardwerke gingen dann seit den 1970ern einen anderen Weg: Man legte Kriterien dafür fest, wann Substanzkonsum als problematisch gilt. Dafür gibt es jetzt das im Deutschen unschöne Wort der Substanzkonsumstörung (englisch substance use disorder, SUD). Kennzeichnend hierfür sind einerseits der Kontrollverlust des Konsumierenden; und andererseits das Leiden, die Krankheit und Dysfunktion durch den Substanzkonsum.
Wenn man dann die empirischen Tatsachen anerkennt, dass, erstens, selbst bei den als sehr gefährlich dargestellten Mitteln in aller Regel nur eine Minderheit der Konsumierenden die Kriterien dieser Störung erfüllt und, zweitens, die Verbote den Konsum nicht verhindern, bleibt doch ein sehr großes, fett gedrucktes Prinzip Freiheit übrig.
…und ihre Schranken
Leider wird das bis heute maßgebliche Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Cannabisverbot aus dem Jahr 1994 hier regelmäßig falsch gelesen: Damit war nicht das „Recht auf Rausch“ vom Tisch, sondern nur so ein uneingeschränktes Recht (Beschluss vom 9. März 1994; Rn 119).
Das heißt, auch der Konsum von psychoaktiven Stoffen ist vom Grundrecht auf die Persönlichkeitsentfaltung nach Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz gedeckt. Er darf, wenn überhaupt, nur auf Grundlage eines Gesetzes beschränkt werden. Und im liberalen Rechtsstaat gilt: Erlaubt ist, was nicht verboten ist; das Verbot – wohlgemerkt, das schärfste Mittel des Rechtsstaats – muss hinreichend begründet werden, nicht die Freiheit; es muss zudem verhältnismäßig sein, also zielführend und angemessen; und die Freiheit des Einzelnen endet an der Grenze zur Freiheit anderer.
Dann ist Drogenkonsum vom Prinzip her eher damit zu vergleichen, dass man in seiner eigenen Wohnung nicht beliebig laut und lange Musik hören darf. Denn ab einer bestimmten Lautstärke und Dauer schränkt das die Freiheit der Nachbarn ein, diese Musik nicht hören zu müssen.
Die (Doppel-) Moral von der Geschicht
Damit kommen wir zur Moral zurück: Man muss Drogenkonsum ja nicht gutheißen. (Dann bitte aber auch beim nächsten Bier oder der nächsten Zigarette, vielleicht sogar beim nächsten Tee oder Kaffee daran denken.) Man darf insbesondere niemanden zum Konsum verbotener Substanzen auffordern, denn das kann genauso hart wie der Drogenbesitz oder Körperverletzung bestraft werden (§ 29 Abs. 1 Nr. 12 BtMG).
Man kommt aber auch nicht einfach so aus dem Dilemma heraus, dass einerseits Drogenkonsum zwar mit Risiken einhergeht, auch wenn diese in der Regel beherrschbar sind und von vielen Nebenfaktoren abhängen, einschließlich der Verbotspolitik; und dass andererseits Menschen (und sogar manche Tiere) immer schon psychoaktive Substanzen konsumiert haben – und das auch weiterhin tun werden.
Wie lange man sich den sinnlosen Kampf gegen die Vorlieben großer Bevölkerungsteile in Zeiten knapper Ressourcen noch leisten will, wird in den nächsten Jahrzehnten auch aufgrund des demografischen Wandelns und dem zunehmenden Mangel an Arbeitskraft zur immer drängenderen Frage werden. Man kann sich darauf besinnen, dass Drogenverbote von Anfang an auf Lügen basierten: Opium zum Beispiel galt lange Zeit als wichtigstes Heilmittel der Ärzte schlechthin. Mit politisch-religiösen Fanatismus dämonisierte man es und wollte man gleichzeitig die chinesischen Einwanderer, die es gerne rauchten, loswerden.
Beides ging nach hinten los: Die Einwanderer blieben und kosteten auf dem Weg ins Gefängnis und während des Aufenthalts darin gesellschaftliche Ressourcen; und anstatt unruhigen Kindern ein paar Tropfen der natürlichen Opiummilch zu geben, verabreicht man heute massenweise sogenannte Antidepressiva, Angstlöser und ADHS-Medikamente. Übrigens verschwand Opium trotz der Dämonisierung nie ganz aus der Apotheke, denn seinen angeblich höllischen Wurzeln zum Trotz enthalten auch heute noch manche Erkältungsmittel seinen Bestandteil Codein – gegen Hustenreiz und für ein besseres Gefühl.
Cannabis landete vor hundert Jahren aufgrund eines politischen Kuhhandels unter Federführung der Ägypter und ebenfalls mit Lügen auf der Verbotsliste. Das Fremdwort „Marihuana“ wurde bewusst gewählt, weil das gefährlicher klang. Um sich davon einen Eindruck zu verschaffen, kann man sich den offiziellen amerikanischen Propagandafilm „Reefer Madness“ aus dem Jahr 1936 ansehen. („Reefer“ ist Slang für Joint oder Cannabiszigarette.)
Elend
Wie gesagt, man muss Drogenkonsum ja nicht gut finden. Aber gerade als ehrlicher Bürger sollte man die politischen Lügen mit ihren dramatischen gesellschaftlichen Folgen nicht immer weiter an der Wahlurne stützen. Die Verbotspolitiker spielen mit der Angst, die sie selbst schüren. Und die meisten Medien spielen das Spiel aufgrund ihrer Aufmerksamkeitsinteressen mit. Wie die Drogenangst und -Panik schon in der Weimarer Republik politisch-medial konstruiert wurde, hat zum Beispiel die Sozialwissenschaftlerin Annika Hoffmann in ihrer Doktorarbeit nachgewiesen.
„Aber sind nicht gerade die ‚harten‘ Drogen gefährlich?„, fragen viele. Das können sie sein, ja, ebenso wie das Schlucken von zu viel Alkohol oder Paracetamol. An einer Überdosis dieser beiden Substanzen wird man aber eher zugrundegehen als an zu viel Cannabis oder Psilocybin – trotzdem kann man sie überall mehr oder weniger frei kaufen. Warum? Weil die allermeisten Menschen gelernt haben, damit verantwortungsvoll umzugehen.
Vergessen wir dabei nicht, dass die Unterscheidung in „weiche“ und „harte“ Drogen schon ein Eingeständnis der Verbotspolitiker war: dass nämlich die Drogenpropaganda im 20. Jahrhundert mit ihrer Dramatisierung der Nebenwirkungen weit überzogen war. Anstatt vom eingeschlagenen Irrweg abzuweichen, hielt man die Verbote insgesamt instand, indem man Delikte wegen (angeblich) weniger gefährlichen Substanzen weniger hart bestrafte.
Es gibt Leute, die aus Neugier psychoaktive Substanzen konsumieren – dann problematischen Konsum entwickeln und nicht mehr davon loskommen. Das höchste Risiko dafür haben aber Menschen mit traumatischen Erfahrungen oder in schweren psychosozialen Verhältnissen. Erinnern wir uns, dass im Vietnamkrieg viele US-Soldaten ihr Elend dieser Hölle auf Erden mit Heroin erträglicher gestalteten.
Sie konnten die aus der Veredlung natürlichen Opiums gewonnene Droge rauchen anstatt spritzen, weil sie in Vietnam günstig, in großen Mengen und in hoher Qualität verfügbar war. Damit fielen auch die Gesundheitsrisiken des Spritzens weg. Aus heutiger Sicht frappierend ließen die allermeisten von ihnen nach der Rückkehr in die Heimat davon wieder die Finger. Und diejenigen, die auch zurück in den USA weiter Heroin nahmen, hatten meist schon vor dem Kriegseinsatz psychosoziale Schwierigkeiten, die sie für problematischen Substanzkonsum anfällig machten.
Opioide
Heute sind viele Opiate – das sind Opioide natürlichen Ursprungs wie Opium, Morphium oder Heroin – und synthetische Opioide verboten. Trotzdem sind wahrscheinlich mehr Menschen denn je von den Opioiden Oxycodon und Fentanyl abhängig, die beide auch als wichtige Medikamente gelten.
Das Problem besteht fort, ganz gleich ob man es drogenpolitisch leichter oder härter anpackt. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass es hier im Kern gar nicht um die richtige Drogenpolitik geht. Vielmehr verschwindet soziale Not hinter der Chiffre der „gefährlichen“ Substanz: Die Menschen gelten dann nicht als Betroffene von Traumata, ungleichen Chancen, Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung, verwahrlosten Familien oder Strukturen. Nein, stattdessen haben sie nach dieser Lesart individuell die falschen Entscheidungen getroffen.
So kann man eine Politik der sozialen Härte mit fehlender Partizipation bestimmter Schichten und wachsenden Unterschieden zwischen Reicheren und Ärmeren ganz im Sinne des Neoliberalismus verklären: Es ist doch deren Schuld, wenn sie Drogen nehmen und die Kontrolle darüber verlieren. Wohlgemerkt, schon in der Antike hatte das griechische Wort pharmakon neben „Arznei“ und „Gift“ auch die Bedeutung „Sündenbock“.
Verstetigung der Probleme
Die so individualisierten Probleme von Menschen werden dann, sofern verfügbar, suchtmedizinisch zwar entschuldigt. Indem man das Phänomen in den Bereich der Krankheit aufnimmt, verschwindet – zumindest theoretisch – die Schuld. Aber in der Praxis ist dem natürlich nicht so und sucht man die soziale Distanz zu den „Alkoholikern“, „Drogensüchtigen“ oder „Junkies“. Jedenfalls dann, wenn man nicht gerade in der Sozialarbeit tätig ist.
Diese Suchthilfe kommt aber eigentlich immer zu spät. Und auch sie verstetigt durch die Behandlung der Symptome die eigentlichen Ursachen des Problems. Wenn man heute die Massen der Drogenabhängigen in amerikanischen Großstädten in ihren Zombie-mäßigen Zuständen – die meisten sind schwarz, viele kommen aus schwierigen Verhältnissen, viele beides – sieht, kann man verzweifeln:
Welche Perspektive haben diejenigen, die nur noch für den nächsten Rausch leben und sich dafür, wenn es geht, prostituieren, ansonsten betteln und stehlen oder gar rauben? Gezeichnet vom harten Leben auf der Straße, mangelnder medizinischer Versorgung, vielleicht schon mit ein paar Nahtoderfahrungen aufgrund von Überdosierungen. Ein Schuss, eine Pille, lässt das alles für ein paar Momente vergessen, so als hätte man ein normales Leben.
Doch, aufgepasst! Die bei kleiner Dosierung gewünschte Unterdrückung des Hustenreizes führt bei zu hoher Dosierung zum Bewusstseinsverlust mit Atemlähmung. Um das Schlimmste zu verhindern, führen in den USA viele Polizisten und Sanitäter die Gegenmittel mit. Doch mit den neuesten, immer stärkeren Opioiden sind mitunter mehrere Dosen nötig – und irgendwann ist die Grenze des Machbaren einfach über schritten.
Die Lage jetzt und bald
Dass das Problem in den USA so viel größer ist als in anderen Ländern, dass die Verbote alter und neuer Opiate und synthetischer Opioide es nicht verhindern konnten, liegt auf der Hand. Ärzte, Apotheker und Pharmafirmen haben jahrzehntelang an dem Versprechen einer medizinisch möglichen schmerzfreien Welt sehr gut verdient.
Als diese Quellen gesetzlich zum Versiegen gebracht wurden, überließ man die Abhängigen dem gefährlicheren Stoff auf dem Schwarzmarkt. Der seitdem dramatische Anstieg der Drogentoten ist bekannt.
Eine Lösung dieser Tragödie ist nicht in Sicht. In Europa lässt sie sich vielleicht noch verhindern, jedenfalls in diesem Ausmaß. Dabei sollte man die Situation der Betroffenen wenigstens nicht verschlimmern, wenn man sie schon nicht verbessern kann. Eine evidenz- statt ideologiebasierte Drogenpolitik wäre hierfür das Minimum.
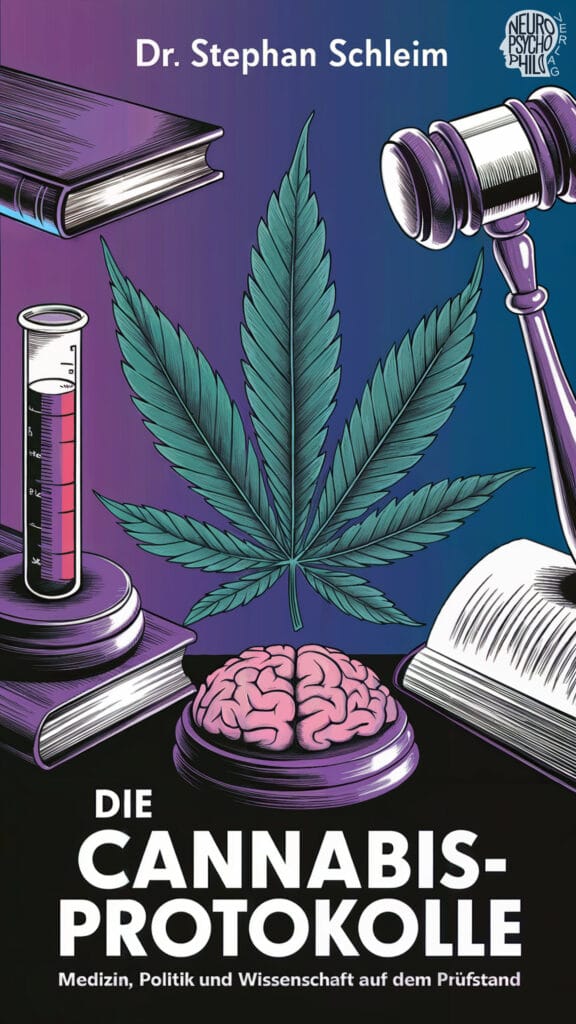
Erfahren Sie mehr über die Cannabis-Gesetzgebung sowie wichtige Grundlagen: Was ist eine Droge? Was ist Abhängigkeit? Seit wann gibt es Cannabiskonsum in der Menschheitsgeschichte? Und was sind sein Nutzen und seine Risiken? Das neue Buch von Stephan Schleim gibt es als eBook für nur 9,99 Euro bei Amazon, Apple Books und Google Play Books.
Abbildung: von Dee, Pixabay-Lizenz.