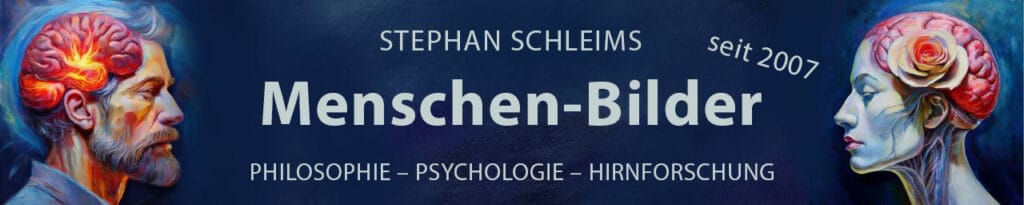Altersgrenzen, Gehirnentwicklung und das (Jugend-) Strafrecht
Legal Tribune Online interviewte mich über mein neues Buch. Eine der Hauptfragen war, ob sich die Altersgrenze für die strafrechtliche Verantwortlichkeit mit Wissen über unsere Gehirnentwicklung besser ziehen lässt.
In meiner Forschung beschäftigte ich mich schon früher mit der Tatsache, dass der niederländische Gesetzgeber die Altersgrenze für die volle strafrechtliche Verantwortlichkeit auf 23 Jahre anhob – und das in zuvor ungekannter Weise mit neurowissenschaftlichen Quellen begründete (z.B. Schleim, 2020).
Nebenbei: Auch wenn das Jugendstrafrecht damit prinzipiell bis zum Alter von 22 Jahren angewendet werden kann, geschieht das in den Niederlanden kaum, in nur ca. 6 Prozent der Fälle; in Deutschland ist das zwar nur bis zum Alter von 20 Jahren möglich, werden dafür aber ca. 66 Prozent der Fälle junger Erwachsener so behandelt. Im Jugendstrafrecht werden das pädagogische Ziel und die Reintegration in die Gesellschaft höher gewichtet. Ein Grund dafür ist die Annahme, dass die Persönlichkeit dann noch beeinflussbarer ist.
Wir sehen international immer mehr Beispiele – viele davon in den USA – dafür, dass in Gesetzesinitiativen eine Anhebung von Altersgrenzen mit der „noch nicht abgeschlossenen Gehirnentwicklung“ begründet wird (Schleim, 2025, Kap. 4). Oft, etwa in der Drogengesetzgebung, ist dann von 25 Jahren die Rede. Deutschen Lesern dürfte das aus der Diskussion um die neue Cannabisgesetzgebung noch gut in Erinnerung sein.
Komplexes Gehirn
Dabei ist allerdings ein Problem, dass es keinen einfachen Marker für die Gehirnentwicklung gibt. Und wenn man aufgrund neuester Forschung verschiedene miteinander vergleicht, zeigt sich dieses Ergebnis:
„Das Volumen der grauen Substanz erreicht seinen Höhepunkt im Durchschnittsalter von 5,9 Jahren, das der subkortikalen Regionen mit 14,4 Jahren und das der weißen Substanz mit 28,7 Jahren. Die mittlere Dicke der Hirnrinde erreicht ihren Höhepunkt sogar bereits mit 1,7 Jahren, die gesamte Gehirnoberfläche mit 11,0 Jahren und das gesamte Gehirnvolumen mit 12,5 Jahren.“ (Schleim, 2025, S. 42)
Dem oft genannten Alter von 25 Jahren kommt das Volumen der weißen Substanz am nächsten, das im Mittel mit 28,7 Jahren sein Maximum erreicht (Schleim, 2025, Abb. 2.4). Diese verbindet verschiedene Gehirnregionen über weite Strecken miteinander. Aber selbst wenn wir das noch nicht angesprochene Problem der individuellen Variabilität beiseitelassen, bedeutet das auch: Ab 29 Jahren nimmt die weiße Substanz allmählich wieder ab. Müssten „Neuro-Gesetze“ das nicht auch berücksichtigen?
Wer für gesetzliche Altersgrenzen die Gehirnentwicklung heranziehen will, steht also vor großen Problemen. Und während die Grenze für die volle strafrechtliche Verantwortlichkeit in den Niederlanden angehoben wurde, wird in Deutschland zurzeit eine Absenkung der Strafmündigkeit von 14 auf z.B. 12 Jahre diskutiert; das Thema spielte sogar im letzten Wahlkampf eine Rolle.
Priorität von Verhalten und Gesellschaft
Laut meiner Forschung – und auch einige Neurowissenschaftler räumen das ausdrücklich ein – kann in dieser Frage in der Biologie keine eindeutige Grenze bestimmen, wie sie für die Anwendung von Gesetzen praktisch sind. Ich empfehle daher, sich nach wie vor in erster Linie am Verhalten und sozialen Umfeld der Betroffenen zu orientieren (Schleim, 2025, Kap. 5). Auch heute schon müssen Jugendstrafrichter in Deutschland beurteilen, ob der Täter (ab 14 Jahren) zum Zeitpunkt der Tat das Unrecht seiner Tat einsehen – und danach handeln konnte (§3 JGG). Eher in Ausnahmefällen könnte hier in der Zukunft ein neurowissenschaftliches Gutachten von Bedeutung sein.
Die Entscheidung, ob man schon unter 14 Jahren strafrechtlich verantwortlich sein kann, ist nach meinem Dafürhalten aber eine politische und keine wissenschaftliche. Schon in Europa gibt es hierzu große Unterschiede und bejaht man dies beispielsweise in Frankreich und Großbritannien.
Aber wenn Kinder unter 14 Jahren häufiger an Straftaten und sogar schweren Gewaltverbrechen beteiligt sind, kann man den Ruf nach einer Herabsenkung der Altersgrenze für die Strafmündigkeit zumindest gesellschaftlich nachvollziehen. Dabei sollte man aber auch bedenken, dass mit dem Wegschließen von Menschen Probleme allenfalls vorübergehend gelöst werden, damit auch gesellschaftliche Kosten verbunden sind – und längerfristige kriminelle Karrieren mitunter erst im Gefängnis anfangen.
Doch auch wenn laut kriminologischen Daten in junge Menschen in vielen Ländern häufiger Straftaten begehen als andere Altersgruppen, ist die gute Nachricht: Diese kriminelle Tendenz verschwindet bei den meisten von ihnen mit der Eingliederung im Erwachsenenleben wieder.
Interdisziplinäre Forschung
Welche Rolle kann ein theoretischer Psychologe oder „Neurophilosoph“ hier eigentlich spielen? Meiner Erfahrung nach ziehen empirische Wissenschaftler mitunter vorschnelle Schlüsse der Art: „Wir haben einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen A und B gefunden, darum sollte man sie normativ unterschiedlich behandeln.“ Als Philosoph weiß man, dass der Schluss von Daten auf Werte, von Wissenschaft auf Moral und Gesetz schwierig ist.
Umgekehrt haben Vertreter der Geistes-, Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften oft nur ein oberflächliches Verständnis der Datengewinnung und -Auswertung in Psychologie und Neurowissenschaften. Dadurch können Einschränkungen des wissenschaftlichen Wissens, die insbesondere für seine praktische Anwendung von Bedeutung sind (Schleim & Roiser, 2009), übersehen werden. Und im Bereich von „Gehirn & Recht“ kann sehr viel auf dem Spiel stehen.
Anders als andere Forscher, die zum Einwerben von Drittmitteln „das nächste große Ding“ versprechen, habe ich hier auch keinen finanziellen Interessenkonflikt.
Nebenbei: Mit den normativen Implikationen der Hirnforschung beschäftigte ich mich schon während meiner Doktorarbeit (2005-2009). Der Titel meiner Dissertation lautet dann auch: „Norms and the Brain“. Damals standen aber die Moral im Vordergrund, nicht das Recht. Die für diesen Artikel zugrunde liegende Forschung wurde zum Teil auch vom Niederländischen Forschungsrat (NWO) im Rahmen meines Projekts „The History of Neuroethics“ gefördert (siehe auch Schleim, 2023) und die Veröffentlichung des neuen Buchs als open access von der Bibliothek der Universität Groningen.
Neues Buch gratis
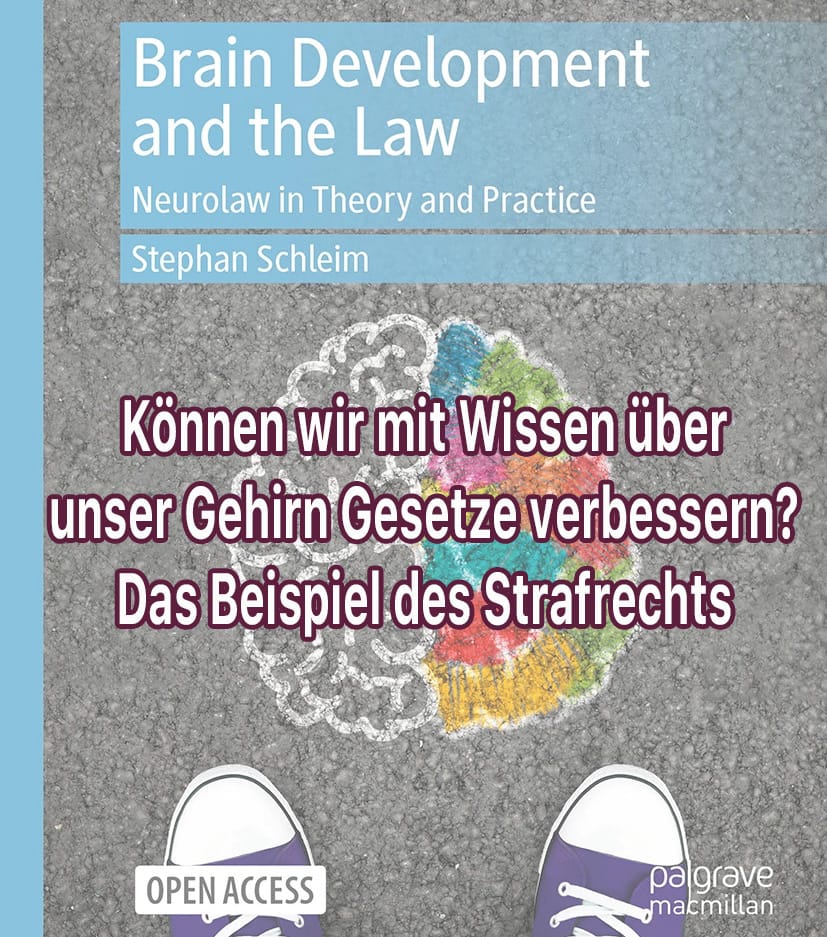
Stephan Schleims neues Buch (open access & peer reviewed) können Sie hier gratis als PDF-, EPUB- und HTML-Version lesen.
Quellen (alles open access):
- Interview (2025): „Strafrecht für Heranwachsende zu milde?“ Legal Tribune Online.
- Schleim, S. (2020). Real Neurolaw in the Netherlands: The Role of the Developing Brain in the New Adolescent Criminal Law. Frontiers in Psychology, 11, 1762, 1-5.
- Schleim, S. (2023). Mental Health and Enhancement: Substance Use and Its Social Implications. Palgrave Macmillan, Cham.
- Schleim, S. (2025). Brain Development and the Law: Neurolaw in Theory and Practice. Palgrave Macmillan, Cham.
- Schleim, S. & Roiser, J. P. (2009). fMRI in translation: the challenges facing real-world applications. Frontiers in Human Neuroscience, 3, 63.