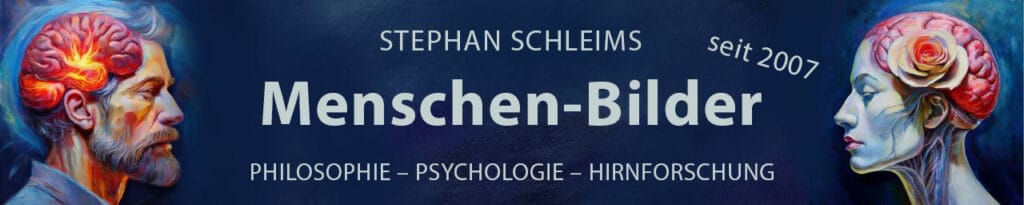Der medienwirksame Patzer der künstlichen Intelligenz von Reddit aus pharmakologischer und drogenpolitischer Sicht
Über den Sinn und Unsinn von künstlicher Intelligenz erscheinen zurzeit fast täglich Nachrichten. Dass man nicht alles, was einem ein Chatbot als Antwort gibt, für bare Münze nehmen sollte, hat sich hoffentlich inzwischen herumgesprochen. Das gilt insbesondere auch für medizinische Themen, wo es um Leben und Tod gehen kann.
Englischsprachige Medien, zum Beispiel die Newsseite des PC Magazine vom 17. Oktober 2025, berichteten nun von einem Fauxpas des Chatbots der beliebten Diskussionsplattform Reddit. Dieser wird mit Antworten der eigenen Nutzerinnen und Nutzer trainiert. Und laut den Berichten empfahl der Reddit-Bot nun Heroin zur Schmerzbehandlung. Dabei verwies er auf den Kommentar eines Nutzers, der behauptete, die Droge habe ihm das Leben gerettet.
Tipp: Mit einem Abonnement des Newsletters verpassen Sie keinen Blogbeitrag mehr.
Was ist eigentlich Heroin?
Wahrscheinlich wissen die meisten Leserinnen und Leser nicht genau, was Heroin eigentlich ist. Sie glauben nur so viel: Es ist eine ganz schlimme Droge, von der man ganz schnell abhängig wird und die bei Überdosierung zum Tod führen kann.
Fangen wir am Anfang an: „Heroin“ ist kein pharmazeutischer Name. Ursprünglich – das ist 1898 – war er ein von der heute noch in der chemischen Industrie tätigen Bayer AG eingetragener Markenname. Zum ersten mal produziert wurde die Substanz übrigens im Bayer-Stammwerk in Wuppertal-Elberfeld.
Im 19. Jahrhundert interessierten sich Chemiker für das seit Jahrtausenden medizinisch und in manchen Kulturen auch als Genussmittel verbreitete Opium. Der Milchsaft, die wörtliche Bedeutung des altgriechischen Worts „opium“, der botanisch Papaver somniferum (Schlafmohn) genannten Pflanze produziert unter geeigneten klimatischen Bedingungen eine hohe Konzentration psychoaktiver Stoffe.

Der Schlafmohn: Grundstock aller Opiate. Foto von Sabine Löwer, Pixabay-Lizenz.
Nachweislich über Jahrhunderte, wahrscheinlich aber viel länger, rätselte die Ärzteschaft, woher die medizinisch nützlichen Eigenschaften des Opiums rührten: Es konnte beruhigen, beim Einschlafen helfen, unterdrückte den Hustenreiz, half bei Durchfall, linderte Schmerzen und wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Erstaunlicherweise konnte es aber auch berauschen und wurde darum auch für Kämpfe eingesetzt. Entsprechend der alten Säftelehre oder Naturphilosophie vermutete man, dass es mal besondere „kalte“, mal „warme“ Eigenschaften des Opiums seien, die diese Effekte hervorrufen.
Erst die moderne Naturwissenschaft lüftete das Rätsel: Ebenso wie das Cannabisharz enthält auch die Opiummilch eine Vielzahl auf das menschliche Nervensystem wirkende Substanzen. Über diesen Gleichklang von menschlichem Gehirn und Erdenpflanzen nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip kann man staunen. Man nannte im 20. Jahrhundert die neuronalen Rezeptoren – Endocannabinoid- oder Opioid-Rezeptoren – nach den Pflanzen, nicht umgekehrt.
Doch zunächst isolierte man im 19. Jahrhundert aus der Vielzahl der Opium-Stoffe das nach dem griechischen Gott des Schlafs benannte Morphin oder Morphium als denjenigen mit dem stärksten schmerzlindernden Effekt.
Schmerzstillung
Als man dann auch noch die Spritze entwickelte und die Substanzen nicht mehr indirekt über den Speise- und Verdauungsapparat verabreichen musste, stand der Menschheit ein sehr viel stärkeres Betäubungsmittel zur Verfügung denn je zuvor.
Nebenbei: Auch Kokain wurde damals als praktisches Anästhetikum erkannt. Während der Kokainliebhaber Sigmund Freud (1856-1939) damit allerdings eine Patientin fast umbrachte und mit dem gescheiterten Versuch, die Opiumabhängigkeit mit dem anderen Rauschmittel zu behandeln, sein öffentliches Ansehen ruinierte, erntete ein anderer Wiener Arzt die Lorbeeren der betäubenden Eigenschaften. Es war Freuds Kollege Carl Koller (1857-1944), der mit Kokain den Augenmuskel vorübergehend anästhesieren und damit chirurgischen Eingriffen an diesem sensiblen Organ einen Teil ihres Schreckens nehmen konnte.
Bleiben wir aber beim Opium und seinen Abkömmlingen. Morphium verbesserte also die Schmerztherapie enorm. Es war schnell nicht mehr aus der Feldapotheke der Militärärzte wegzudenken. Betäubt vom Saft des Schlafgotts fühlte manch ein versehrter Soldat nicht einmal mehr die Amputation eines Gliedes. Der körperliche wie psychische Schmerz würde erst später auftreten.
Man hätte auch auf das Kriegführen verzichten können. Doch wir sind ja Menschen.
Übrigens gönnte sich so mancher Arzt hin und wieder einen Schuss Morphium als Aufputschmittel. Hierin äußert sich schon die Janusköpfigkeit so gut wie aller Medikamente beziehungsweise Drogen: Die starken Schmerzmittel konnten oft helfen, manchmal vielleicht sogar heilen, mitunter aber auch als Rauschmittel missbraucht werden.
Unter den Eindrücken des Ersten Weltkriegs promovierte 1919 der in Frankfurt am Main geborene, 1938 wegen seiner jüdischen Herkunft in die USA geflohene Arzt und Philosoph Erwin W. Straus (1891-1975) „Zur Pathogenese des chronischen Morphinismus“ – gerade einmal 16 Seiten reichten für ihn zum Doktor der Medizin. In einzelnen Fallgeschichten beschrieb er, wie Menschen morphiumabhängig wurden. In der Regel hatten sie schwere Schicksale erlebt, worauf wir später noch einmal zurückkommen.
Veredelung
Wozu aber dieser Umweg über Opium und Morphium, wo es doch um Heroin gehen soll? Nun ja, weil Heroin nichts anderes ist als – veredeltes Morphium. Der deutsche Chemiker und Bayer-Angestellte Felix Hoffmann (1868-1946) erzeugte es, indem er Morphium mit Essigsäureanhydrid reagieren ließ. Ihm hat der Konzern übrigens auch das Aspirin zu verdanken.
Chemisch heißt das Ergebnis der Reaktion eigentlich Diamorphin. Marketing-Leute von Bayer hielten dann aber „Heroin“ für einen besseren Handelsnamen. Und weil die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie damals Weltmarktführer war, verbreitete der Name sich auf dem Globus.
Opium, Morphium oder gar Heroin waren damals in vielen gängigen Erkältungs- und Grippemitteln enthaltene Wirkstoffe. Wer sich sozusagen schon die halbe Lunge herausgehustet hat, dürfte sich über die Stillung des Hustenreizes freuen. Die Aufhellung des Gemüts, die man den Drogenabhängigen als „Euphorie“ vorwirft, nimmt man gerne als Begleiterscheinung in Kauf.
Wer sich jetzt empört, dass diese Mittel, allgemein „Opiate“ genannt, damals sogar zur Anwendung bei Kindern beworben und frei verfügbar waren, sollte einen Moment innehalten: Denn noch heute gibt es in der Apotheke Grippemittel mit einem anderen Opiat, nämlich Codein. Auch dieses ist in der natürlichen Opiummilch enthalten.
Hin und wieder hört man davon, dass hohe Mengen dieses Hustensafts in der Hip Hop-Szene beliebt sind, mit dem Szenenamen „Lean“. Dem einen oder anderen wurde das zum Verhängnis. Bei Überdosierung kann aus der Unterdrückung des Hustenreizes nämlich die lebensgefährliche Betäubung der Atemmuskulatur werden. Außerdem wird dem Hustensaft neben dem Opiat oft auch Paracetamol hinzugefügt, das in hohen Mengen die Leber schädigt. Als Heroinersatz sollte man ihn daher nicht verwenden.
Trotzdem ist Diamorphin alias Heroin eigentlich das medizinisch bessere Produkt. Denn aufgrund der chemischen Veredlung passiert es die Blut-Gehirn-Schranke schneller. Wenn man es richtig anwendet, kann man damit also gezielter behandeln als mit Morphium.
Medizin, Droge oder Gift?
Im Wort „pharmakon“ der alten Griechen steckt mehr Weisheit, als man heute in gesundheits- und drogenpolitischen Diskussionen findet: Es bedeutete nämlich sowohl Arzneimittel als auch Gift. Im Englischen ist man sprachlich noch näher an dieser Realität dran, weil „drugs“ Arzneimittel und verbotene Drogen sein können.
„Droge“, wahrscheinlich von niederländisch „droog“ für trocken, was sich auf getrocknete Kolonialwaren bezog, die man in der Drogerie kaufte, ist heute vor allem ein politischer Begriff: Er bezeichnet meist diejenigen Mittel, die eifrige Politiker auf die Verbotsliste setzen. Und, ja, darauf findet sich natürlich auch Heroin.
Die Verbote der Opiate wurden vor ziemlich genau 100 Jahren auf den Opiumkonferenzen mit internationaler Verbindlichkeit durchgedrückt. Dem ging vor allem in den USA die Dämonisierung der teils seit Jahrtausenden bewährten Arzneimittel und Handelsgüter durch puritanische Extremisten voraus: Was früher (und teils noch heute) als unerlässliche Medizin galt, sollte auf einmal die Geißel der Gesellschaft sein.
Die Frage, ob Diamorphin nun Medizin oder Rauschgift ist, hängt daher vom Standpunkt ab. Bis heute gibt es Ärzte, die es bei Lungenerkrankungen einsetzen wollen. Politisch haben sie einen schweren Stand, weil viele die H-Substanz für die absolute Horrordroge halten.
Doch warum haben dann viele von uns, mich eingeschlossen, schon stärkere Opiate wie Oxycodon vom Arzt bekommen? Mir wurde es sogar ohne Vorwarnung bei einer Operation verabreicht – und ich wachte in einem starken, euphorischen Rausch auf. Wenn Heroin der Horror ist, dann müsste man Oxycodon eigentlich als Über-Horror ansehen.
Diese Doppelmoral findet man auch im deutschen Betäubungsmittelgesetz wieder: Will man die Substanz verbieten, dann setzt man sie als „Heroin“ auf Anlage I der „nicht verkehrsfähigen“ Mittel; will man die medizinische Abgabe zur Substitutionstherapie nach § 13 BtMG regulieren, dann spricht man ausschließlich vom „Diamorphin“. Dabei ist die Substanz immer dieselbe.
Rassismus und Kolonialismus
Praktischerweise hatten und haben in den USA vor allem Randgruppen einen problematischen Konsum, also meist Einwanderer und Schwarze. Das verdeutlicht die kolonialistische und sozialpolitische Dimension der Drogenpolitik. Der Neuropsychopharmakologe Carl L. Hart, nach eigenem Bekunden der erste schwarze Professor in dieser Funktion an der angesehenen Columbia University in New York, hat dafür in seinem Buch Drug Use for Grown-Ups viele Beispiele gesammelt.
Demnach ist nicht nur angeblicher Cannabisgeruch im Auto vor allem in konservativen US-Bundesstaaten eine häufige Begründung der Polizei, um Schwarze und migrantisch aussehende Bürger harten Maßnahmen zu unterziehen – immer wieder mit tödlichem Verlauf. Auch historisch sei man gegen den Substanzkonsum von Nicht-Weißen immer besonders hart vorgegangen. Als man schließlich die – übrigens bis heute bestehenden – Probleme der Verbote von Opiaten einsah, ließ man die Substitutionstherapie an speziellen Abgabestellen zu. Weil das Warten in der Schlange vor allem von Weißen als Demütigung erfahren wurde, so Hart, habe man dann doch die diskrete Abgabe beim Arzt erlaubt.
Und während ich diese Zeilen schreibe, droht der US-Präsident Venezuela mit Kriegsschiffen und einem Flugzeugträger. Angeblich geht es darum, Drogenkuriere zu bekämpfen. Dabei waren es die US-eigenen Ärzte, Apotheker und Pharmafirmen, die überhaupt erst so viele Bürgerinnen und Bürger von den heutigen, so viel stärkeren Opium-artigen Mitteln – wörtlich: Opioiden – abhängig machten.
Sie haben den Menschen ein schmerzfreies Leben versprochen. Das war zwar eine Lüge, doch hervorragend fürs Geschäft. Manche nennen es „Das Verbrechen des Jahrhunderts„.
Mit dem desolaten Resultat lassen sich heute nicht nur die sozial Schwachen polizeilich kontrollieren, sondern international machtpolitische Ziele rechtfertigen. Auch Erzfeind China warf man schon vor, die Heimat mit den Drogen zu überfluten. Der Weltmacht konnte man zur Strafe allerdings nicht militärisch, dafür aber mit Einfuhrzöllen und Sanktionen drohen.
Doppelte Stigmatisierung
Im Vietnamkrieg (ca. 1955-1975) hielten sich viele US-Soldaten mit Heroin über Wasser. Nahe an der Quelle und aufgrund niedriger Preise und der hohen Qualität konnten sie es aber rauchen, was ungefährlicher ist als der direkte Weg über die Spritze. Interessanterweise hörten viele nach der Rückkehr in die Heimat wieder auf. Den problematischen Konsum behielten vor allem diejenigen bei, die vorher schon psychosoziale Probleme hatten.
Und so kommen wir zu meiner Hauptkritik an den Drogenverboten: Denn international replizierte Studien mit Hunderttausenden Personen zeigten immer wieder, dass Menschen mit traumatischen Erfahrungen ein viel größeres Risiko für den exzessiven Gebrauch von Rauschmitteln haben. Wenn diese darum polizeiliche Maßnahmen erfahren, erhalten sie nach ihrem psychosozialen Pech jetzt ein weiteres, diesmal institutionelles Unglück.
Sie werden gewissermaßen für ihre alte Stigmatisierung erneut stigmatisiert. Wie kann das gerecht sein? Und selbst wenn die Drogen wirklich so gefährlich wären, wie es immer wieder heißt: Man ist in so gut wie allen Ländern aus Gründen der Menschenwürde auch davon abgerückt, Menschen für Suizidversuche zu bestrafen.
Horror Heroin
Es sollte klar geworden sein, dass in der Öffentlichkeit ein verzerrtes Bild über Diamorphin alias Heroin verbreitet wurde. Das verdeutlicht auch die folgende Abbildung mit historischen beziehungsweise aktuellen Produkten.

Zwei Namen, eine Substanz: Links eine Werbung für Heroin von Bayer, wahrscheinlich um 1920, in New York. Vor den Dämonisierungskampagnen waren Opiate als Erkältungsmittel beliebt. Codein-Präparate gibt es noch heute. Rechts ein aktuelles pharmazeutisches Produkt aus dem Vereinigten Königreich. Lizenz: Pete Chapman, CC BY-SA 3.0
Aber ist Heroin nicht gefährlich? Ja, natürlich – wenn man es falsch konsumiert. Die Verabreichung sicherer Produkte ist eine Hauptaufgabe der Pharmafirmen und Apotheken. Umgekehrt können auch viele frei verkäufliche Substanzen bei falscher Verwendung zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar dem Tod führen.
Interessanterweise sind die oft mit Heroin verbundenen Gesundheitsprobleme – wie AIDS/HIV oder Hepatitis – gar keine Nebenwirkung der Substanz, sondern von verunreinigtem Besteck. Bei richtiger Anwendung der Opiate ist eine häufige Nebenwirkung: Verstopfung.
Das Abhängigkeitsrisiko wächst mit der Dauer der Verwendung. Wer seine körperlichen oder psychischen Schmerzen anders nicht verträgt, muss mit der Zeit wahrscheinlich die Dosis erhöhen. Das körpereigene Opioid-System passt sich an die von außen zugeführten Mengen an. Wenn man dann aufhört, erlebt man wahrscheinlich noch viel stärkere Schmerzen als vorher. Die konnte man ja auch schon nicht ertragen. Willkommen im Teufelskreis der Sucht.
Darum sollen die hier genannten Substanzen auch gar nicht verharmlost werden. Ich glaube allerdings, dass man das zunehmende Drogenproblem nicht ohne ehrliche Aufklärung wird lösen können. Dazu gehört auch, von der Ursache her psychische oder soziale Probleme nicht fälschlich als Drogenprobleme darzustellen, wie es in Politik und Medien leider tagtäglich passiert.
Drogen- statt soziales Problem
Die allgemeine Verelendung wird auch in vielen europäischen Städten zu einem immer größeren und sichtbareren Problem. Arme und Obdachlose sind die andere Seite der Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft. „Sollen sie sich doch eine Arbeit suchen – oder reiche Eltern zum Erben!“
Das niederländische Rotterdam – um nur ein Beispiel zu nennen – ist eine der Städte mit besonders großen Problemen. Weil sich die „guten“ Bürgerinnen und Bürgern dadurch zunehmend gestört fühlen, diskutiert man jetzt kreative Lösungen: So soll etwa die im Stadtzentrum gelegene Pauluskirche, in der viele Arme, Obdachlose und Drogenabhängige Hilfe suchen, in einen Außenbezirk umziehen. Aus den Augen, aus dem Sinn.
Die sozialen Probleme löst man damit nicht. Da diese die andere Seite der Ungleichverteilung des Wohlstands sind, nimmt man sie vorzugsweise als Drogenproblem wahr. Dann kann man den Substanzen die Schuld geben und das Problem in den Bereich von Polizei und Justiz verschieben; dann ist nicht mehr die Gesellschaft in der Verantwortung, sondern die Drogen und die angeblich willensschwachen Individuen.
Ist es Zufall, dass im Altgriechischen der „pharmakos“ der Sündenbock war? Auch in diesem Sinne passen die Substanzen 2000 Jahre später noch zur ursprünglichen Wortbedeutung.
Fazit
Wenn also ein Chatbot im Jahr 2025 Heroin als Schmerzmittel empfiehlt, dann ist das pharmakologisch konsistent. Die Entrüstung in den Medien sagt mehr über unsere drogenpolitische Indoktrination aus.
Diese Indoktrination wird immer dogmatischer: Alkohol gilt jetzt als Gift, vom ersten Tropfen an. Der Diabetologe und Bestsellerautor Matthias Riedl nannte kürzlich sogar Zucker ein „dosisabhängiges Gift“. Ja, würde man den Zucker aus einem gängigen Schokoriegel direkt ins Blut spritzen, wäre das tödlich. Über den Verdauungsapparat können die meisten Menschen die Menge aber problemlos regulieren – jedoch nicht die Zuckerkranken.
Die antike Idee von „pharmakon“ – Arzneimittel und Gift – drückte es eigentlich perfekt aus. Dosis, Art und Zweck des Konsums entscheiden über Nutzen und Gefährlichkeit. Dabei sind die Substanzen ohne Qualitätskontrollen vom Schwarzmarkt am gefährlichsten.
Opium, Codein, Morphium, Diamorphin/Heroin, Oxycodon, Fentanyl sind alles Opioide mit zunehmender Potenz. Keines ist moralisch schlechter als das andere, wenn man es denn richtig anwendet. Der Rest ist politisches „Framing“.
Diesen Griff in die Trickkiste sehen wir auch beim Cannabis: Verschreiben Ärzte es selbst, dann betonen sie den medizinischen Nutzen; besorgen die Menschen es sich selbst, dann ruft man „Psychoserisiko!“ und „Hirnschaden!“. Es scheint, als könnten die Moleküle die Gedanken der Menschen lesen.
Das ist kein Plädoyer für eine radikale Freigabe aller psychoaktiven Substanzen. Aber es ist ein Fingerzeig darauf, dass man das Drogenproblem nicht lösen kann, ohne psychologische Traumatisierung und soziale Ausgrenzung aufzufangen.
Die deutsche Drogenpolitik scheint diese historische Wahrheit immer noch zu ignorieren: Die ohnehin bescheidenen Fortschritte durch die Entkriminalisierung von Cannabis sollen jetzt zum Teil wieder rückgängig gemacht werden, wenn es nach führenden Unionspolitikern geht. Nun ja, wenn man sein „Kraut“ nicht mehr bequem bei der Online-Apotheke bestellen kann, werden die Dealer vor Ort wieder vermehrt die Nachfrage bedienen.
Anstatt wichtige Probleme zu lösen, werden so beständig neue geschaffen.
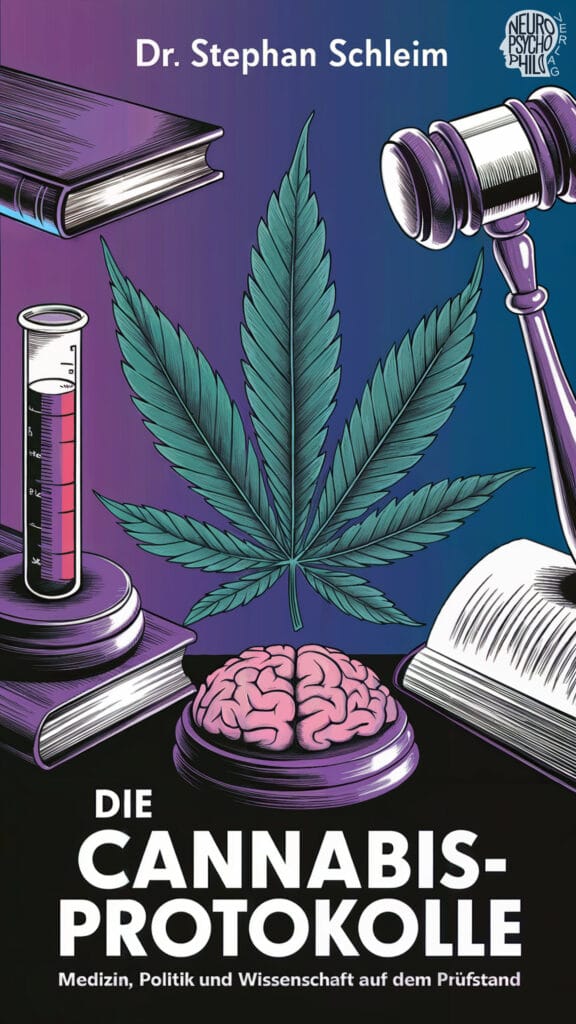
Erfahren Sie mehr über die Cannabis-Gesetzgebung sowie wichtige Grundlagen: Was ist eine Droge? Was ist Abhängigkeit? Seit wann gibt es Cannabiskonsum in der Menschheitsgeschichte? Und was sind sein Nutzen und seine Risiken? Das neue Buch von Stephan Schleim gibt es als eBook für nur 9,99 Euro bei Amazon, Apple Books und Google Play Books.
Titelgrafik: von Sabine Löwer, Pixabay-Lizenz.